«Verzell du das em Fährima!»
Relativ klein ist die Zahl der «unheimlichen Geschichten», deren Bezeichnung aus dem Untertitel der 1952 bis 1964 durch die Abteilung «Unterhaltung» produzierten Serie «Verzell du das em Fährima!» (14 Folgen) abgeleitet ist. Dass dieser erfolgreichen Reihe – sie zählte einst zu den legendären «Strassenfegern» – die von den Briten stets geförderte Kunst des Geschichtenerzählens zugrunde liegt, geht unter anderem aus Hans Hausmanns Bericht über deren Entstehung hervor.1 Als Anregung diente der englische Spielfilm «Dead of Night» des brasilianischen Regisseurs Alberto Cavalcanti, dessen Rahmen darin bestand, dass sich fünf Golfspieler, die wegen anhaltenden Regens nicht spielen können, zum Zeitvertreib gegenseitig Geschichten erzählen. Aus diesem letztlich an Boccaccios «Decamerone» orientierten Konzept entstand eine lockere Folge von Sendungen, die alle nach demselben Grundmuster gebaut waren: Eine kleinere Gruppe von Leuten, die aus irgendeinem Grund von der Aussenwelt isoliert und für längere Zeit an einem Ort festgehalten sind, vertreibt sich die Zeit durch Erzählen von «unheimlichen und unerklärlichen Geschichten», die einzelne Anwesende persönlich erlebt haben. Diese steigern die Wirkung der meist bedrohlichen, unheimlichen Situation, in der sich die Gruppe befindet. Am Schluss, wenn sich die Lage zu normalisieren und rational zu klären scheint, wird durch Einwirken von Kräften aus der «vierten Dimension» eine Pointe gesetzt, die die Zuhörenden verunsichern und sie erschaudernd zurücklassen soll. In die szenisch gestaltete Rahmenhandlung werden die erzählten Episoden eingebettet, deren epische Form jeweils rasch in szenische Rückblenden übergeht. Die einzelnen Stories wurden entweder von Klassikern des Genres, etwa von Edgar Allan Poe, entlehnt, extern In Auftrag gegeben oder von den Mitarbeitern der Basler Unterhaltungs-Abteilung von Radio Beromünster – Hans Hausmann, Werner Wollenberger, Albert Werner und Rainer Litten – selbst geschrieben. An der ersten Folge vom 5.1.52 arbeitete unter anderen Friedrich Dürrenmatt mit, der kurz zuvor bei Studio Bern als Hörspielautor debütiert hatte.
Obwohl Ernst Bringolf 1940 zu einer Hörspieladaption von Werner Jukers Schauspiel «Der Blick hinüber» kritisch vermerkte, «Spiritismus, Materialisation, Horoskopie, Magie, Grenzen des Rationalen und Irrationalen, Hypnose, Hellsehen usw.» seien zu geläufigen Begriffen geworden und entsprächen den «Tendenzen der Zeit»2, wurden offenbar bis zur «Fährima»-Serie keine Originalhörspiele von Schweizer Autoren in der Art dieser «unheimlichen Geschichten» gesendet. Dass aber diese Produktionen In ähnlichem Sinne rezipiert werden wollten wie etwa die in den dreissiger und vierziger Jahren öfter produzierten Märchen für Erwachsene3 und insofern mit diesen verwandt sind, geht unter anderem aus dem Titel hervor: Die Redensart «Verzell du das em Fährima!» verwendet der Basler, um auszudrücken, dass er eine Schwindelei durchschaut hat. Sie wird in etwa synonym verwendet zum Satz: «Erzähl mir keine Märchen», den der Märchenforscher Max Lüthi als Beleg für unsere ambivalente Haltung gegenüber dieser Gattung anführt. Im norddeutschen Ausdruck «Löögschen» ist noch fassbar, wie nahe bei der Lüge Märchen und ähnliche Geschichten durch den Sprachgebrauch angesiedelt werden.4 Andererseits wird im überaus positiven Sinn des Ausdrucks «märchenhaft» für etwas ausserordentlich Schönes das Faszinosum spürbar, das dieser uralten Form der Volkspoesie anhaftet. Der «Fährima» steht ja auch als Symbolfigur für das «Übersetzen» zwischen Diesseitigem und Jenseitigem und erweist sich so bei näherem Zusehen als der richtige Adressat für nicht ganz geheure Lügengeschichten, an denen – wer weiss – vielleicht doch mehr dran ist, als Erzähler und Zuhörer wahrhaben möchten.
Märchenhörspiele fallen seit jeher primär in den Zuständigkeitsbereich der Kinder- und Jugendsendungen, obwohl ursprünglich weder die mündlich tradierten Volksmärchen noch eine Grosszahl der Kunstmärchen für Kinder gedacht waren. Schon im ersten deutschsprachigen Hörspiel, «Zauberei auf dem Sender» von Hans Flesch, trat 1924 eine Märchentante auf, um dem ernsten Erwachsenenprogramm des Radios eine Alternative entgegenzustellen. Von den Hörspielverantwortlichen des Radios wird der Unterhaltungswert von Märchen für Erwachsene heute offenbar so gering veranschlagt, dass sich entsprechende Produktionen seit 1965 an den Fingern einer Hand abzählen lassen: Mit Rudolf Kellers Märchenspiel «D’Hauptme-Frau» (1966) in Lenzburger Mundart leistete die Abteilung «Folklore» ihren Beitrag zu diesem Genre. Die Abteilung «Dramatik» produzierte ein «modernes Märchen» von Rudolf Jakob Humm aus dem Jahr 1954 nach dem Stoff seiner gleichnamigen Novelle, «Die vergoldete Nuss» (1978), sowie zwei Kunstmärchen in Ostschweizer bzw. Schaffhauser Dialekt von Fritz Gafner, «D Nachtigall» (1983) und «Gsprööch mit de Schlange» (1984). Gafners zweites Spiel wurde von der Presse als «ein im besten Sinne volkstümliches Stück» begrüsst, das auch von Kindern verstanden werden könne; «der Erwachsene hingegen vermag das kurze, gehaltvolle Märchen verschiedenartig zu deuten, je nach Bildungsgrad und Lebenslage.»5
Während der Titel «Verzell du das em Fährima!» nach der Art mancher Märchenschlüsse die Unwirklichkeit des Geschehens betont und damit die Ratio des aufgeklärten Zuhörers anspricht, teils vielleicht im heimlichen Bewusstsein und zur Legitimation des Unzeitgemässen solcher «unheimlicher Geschichten», teils gerade, um die Neugier auf deren fremdartigen Charakter anzustacheln, ist der Inhalt der Episoden in seiner Realistik mehr der Sage als dem Märchen verwandt. Durch die feste Bindung des Geschehens an einen bestimmten Ort, welche die Sage von dem ins Weite strebenden Märchen unterscheidet6, ist letztlich die episodische Struktur der Sendungen bedingt. Die den einzelnen Teilen zugrundeliegende «Keimform der Sage, dass man zu einer bestimmten Zeit und an einer bestimmten Stelle etwas Unheimliches gesehen habe»7, liefert gerade genügend Stoff für einen Teil eines Hörspiels oder für ein Kurzhörspiel, was durch den Erfolg der jahrezehntelang im Spätprogramm gesendeten «Schreckmümpfeli», meist adaptierte Hör-Spots von bis zu zwölf Minuten Dauer, bestätigt wird. Allzu starke Dehnung schadet der unheimlichen Wirkung. Diese bedarf zur Kontrastierung der möglichst echt wirkenden Gestaltung, welche der vertrauten Alltagswirklichkeit in den Produktionen am nächsten kommt, in denen Dialekt gesprochen wird.
Dokumentarische Exaktheit und «Liebe zum sachlichen Detail» wurden von der Kritik auch in den achtziger Jahren noch ebenso gelobt wie der «versierte Einsatz akustischer Mittel».8 Das geschickte Operieren mit Ambiance und Geräuscheffekten gehört «zum Ungeheuerlichen fast wie das Salz zur Suppe» und scheint die intendierte Wirkung zu verstärken, weil das Radio ohne äussere Bilder auskommt, «die doch gerade das fixieren, von dem ein bisschen offen bleiben muss, ob es nun tatsächlich so war oder nur so schien.»9 Georg Thürer stellte anfangs der sechziger Jahre fest, dass das Radio für unheimliche Geschichten ein geradezu «ideales Medium» sei, und auch die Mitgestalter der «Fährima»-Serie, Rainer Litten und Albert Werner, erfassten mit sicherem Gespür, dass die Realitäts-Vermittlung dann am authentischsten wirkt, wenn sie sich auf die rein akustische Realität des Mediums Radio beschränkt. Indem sie zu Beginn der Rahmenhandlung einer «Fährima»-Folge (1963) den populären Radio- und TV-Moderator Mäni Weber als Kommentator eines Ski-Abfahrtsrennens auftreten liessen, bewegten sie sich bewusst an der Grenze zwischen Hörspiel-Fiktion und Programm-Realität und damit in einer Zone, welche bereits in den dreissiger Jahren – nicht nur von Orson Welles – zur Erzeugung von suggestiven Effekten erschlossen worden war. Was konnte da näher liegen, als den prominenten Skirennfahrer Toni Sailer als Darsteller für die Hauptrolle zu engagieren, wenn sich schon Gelegenheit dazu bot?
Die Präsentation des Fiktionalen als Realität10 scheint konstitutiv für den Typus der «unheimlichen Geschichten» zu sein. Die «Fährima»-Serie zeichnet sich zusätzlich durch ein kontrastierendes ironisch-witziges Moment aus, das dem Schrecken seine Spitze nimmt und damit die leichte Mischung zustande bringt, welche das Geheimnis einer dem easy listening verpflichteten Unterhaltungssendung ausmacht. Ein der Realistik entgegenwirkendes Element sind auch die schrillen Akkorde von Hans Moeckel, die zur Akzentuierung von Titel und Pointen dient und an solchen Stellen für die richtige «Stimmung» sorgt. Mit einer Wiederholung von sechs Folgen der «Fährima»-Serie im Sommer-Reprisen-Programm 1986 entsprach das Ressort «Hörspiel» einem Wunsch, der im Laufe der Jahre von zahlreichen Hörerinnen und Hörern geäussert worden war. Die positive Reaktion überrascht deshalb nicht weiter, wenn man davon absieht, dass unter den Befürwortern erstaunlich viele junge Fans waren. Auch das Echo in der Presse fiel gut aus. Gelobt wurde vor allem die handwerkliche Perfektion der Ausgestaltung durch die Regie und die «Raffinesse» im Gebrauch der Mittel zur Erzeugung der gewünschten Stimmung. Am sachlichsten ist die historisch relativierte Feststellung, dass sich die «Fährima»-Folgen «in den besten Zeiten zu wahren Perlen der Unterhaltungskunst» entwickelt hätten.11 Wer sie aber als «eigentliche Kabinettstücke der Hörspielkunst»12 vorstellt, läuft doch grosse Gefahr, einen eher unbedeutenden Teil der «Hörspielkunst» für das Ganze zu nehmen.
Im subjektiven Bekenntnis einer Kommentatorin, welche die «Fährima»-Folgen zu den «stärksten Äthererlebnissen» ihrer Jugend zählte und ihnen auch 1986 noch Empfindungen des Gruselns abgewinnen konnte13, zeigt sich, dass mit solchen Produktionen starke Rezeptionsbedürfnisse befriedigt wurden, die damals nach wie vor noch akut zu sein schienen und durch das Unterhaltungsangebot des Fernsehens offenbar nicht adäquat befriedigt wurden. «Nostalgische Erinnerungen» an Zeiten, als leichte Radio-Unterhaltung sich im Hörspiel ungehemmt ausleben durfte, drängen in einem Artikel «mächtig in den Vordergrund», der sich damit gegen die «Begleitprogrammideologie» der achtziger Jahre wendet.14 Die «unheimlichen Geschichten» aus der Vorzeit der Abteilungs-Ära erscheinen da nicht «lediglich als pure Unterhaltung», sondern werden zu Werken von höherer sprachlicher und kompositorischer Subtilität stilisiert, die zeigen sollen, «was heutigen Radiomachern an kreativer Phantasie, an kindlicher Spontaneität im Umgang mit dem Medium und an Gestaltungsfreiheit mehr und mehr wirklich abgeht.» Wer aber darin «“verzweifelt-schönes“, durch und durch professionelles und heute sichtlich nicht mehr bezahlbares Hörer-Radio» sieht, verkennt, dass diese Produktionen in Gehalt und Form damals schon hoffnungslos veraltet waren und zur Belebung eines unterhaltenden Hörspiels wenig beitragen können, auch wenn dies noch so nötig sein sollte. Immerhin mögen solche Reaktionen als Indiz für ein beträchtliches Defizit an unterhaltenden Hörspielen gewertet werden. Hans Hausmanns Hinweis, dass es sich bei den «Fährima»-Produktionen um wahre «Geräuschorgien» handelte, deutet auf eine unzeitgemässe Eigenschaft dieser Produktionen hin: Ein vornehmlich jüngeres Publikum schien in solchem «Ohrenschmaus» eine Alternative zum insgesamt eher «wortlastigen» Hörspielprogramm der Abteilung «Dramatik» zu sehen.
Am Rand des Bereichs «unheimlicher Geschichten» steht aufgrund ihres stark dokumentarischen Einschlags Hermann Schneiders Hörspielreihe «’s geischteret in dr Ruetegass» (1967, 5 Folgen), produziert von der Abteilung «Folklore». Dieser letzten Radioarbeit des 1973 verstorbenen Baslers, der 1930 als einer der ersten Hörspielautoren in Erscheinung getreten und der Gattung über Jahrzehnte treu geblieben war, liegen tatsächliche Begebenheiten aus Schneiders Jugendzeit zugrunde.15 Wie in Wirklichkeit, so erweisen sich auch in der fünften Folge des Hörspielzyklus die Spukerscheinungen um ein Kleinbasler «Gespensterhaus» als durchaus diesseitige Phänomene. Dem Schauder des Unheimlichen und der spannenden Handlung hält die Darstellung von Lokalkolorit und Charakteren, die durch die Mundart wirkungsvoll unterstrichen wird, mindestens die Waage. Im Unterschied zum episodischen «Fährima»-Zyklus handelt es sich bei Schneiders Hörspiel um eine integrierte Serie16, deren Teile inhaltlich zusammenhängen und fast wie in einem fünfaktigen Drama aufeinander abgestimmt sind. Eine Gemeinsamkeit besteht in der heiteren Art der Gestaltung. Es ging Schneider nach dessen eigenen Worten «darum, im besten Sinne Unterhaltung zu schaffen», und er wünschte sich, «dass der Hörer den Spass des Verfassers schmunzelnd nacherlebe!»17 Wie die «Fährima»-Geschichten so darf man auch diese Reihe – die letzte Produktion eines Originalhörspiels von einem Schweizer Autor, in welcher der Basler Radiopionier Werner Hausmann Regie führte – einer vergangenen Periode der Schweizer Hörspielgeschichte zurechnen.
«Die tausendundzweite Nacht»
Abgesehen von Einzelproduktionen, in denen Übersinnliches nicht zur Inszenierung von Gruseleffekten thematisierte wird, etwa in «Vermisst wird…» (1970), einem pointierten Kurzhörspiel von Charlotte Ikle, und in «Geischterstund» von Manfred Schwarz (1973), waren «unheimliche Geschichten» während zehn Jahren kein Thema mehr, das Schweizer Autoren beschäftigte, bis 1977 die Geschwister Annemarie und Hans Peter Treichler im Auftrag von Studio Basel ihre Arbeit an einer sechsteiligen Hörspielreihe mit dem Titel «Die tausendundzweite Nacht» aufnahmen. Der Serientitel meint wohl eine moderne Fortsetzung der Erzählungen von Sheherazade aus «Tausendundeine Nacht», der Urform eines Erzählzyklus mit Rahmen.18 Von Annemarie Treichler war zuvor unter dem Titel «Die Galerie» (1975) eine mit einem Rahmen versehene Bearbeitung zweier Gespenstergeschichten von englischen Autorinnen des viktorianischen Zeitalters sowie ein eigenes Originalhörspiel gesendet worden, und Hans Peter Treichlers Originalhörspiel-Erstling «Rufe aus dem Jenseits» (1977) gibt schon im Titel zu erkennen, dass es dabei um Übersinnliches geht.
Die erste Folge der Serie «Die tausendundzweite Nacht», «Konzert im Schloss» (1977), lässt die Zuhörenden im Ungewissen, ob die unheimliche Zeitreise eines Streichquartetts tatsächlich stattgefunden habe oder auf einer Wahrnehmungstäuschung beruhe. In der zweiten Sendung mit dem Titel «Das Bergwerk» (1977) wird eine Gruppe von Lehrern und Schulpflegern auf einer Exkursion in eine Erzgrube mit Spuren eines Schlagwetters konfrontiert, das in ferner Vergangenheit stattgefunden hat. «Die Veteranen» (1978) spielt an Bord einer Jacht, wo drei ehemalige Angehörige der holländischen Marine ihres Entrinnens aus grösster Not im fernöstlichen Kolonialkrieg gedenken und nun, nach mehr als einem Vierteljahrhundert, vom Verhängnis ereilt werden. Im Unterschied zu den folgenden sind die ersten drei Folgen der Reihe nach dem Prinzip der Rahmenhandlung mit Erzählepisoden gebaut, was den beiden Autoren auf die Länge wohl zu schwerfällig und gezwungen erschien.
«Üebig im Gländ» (1979), «Rio Mapiri» (1979), und «Wassergäng» (1979) verzichten auf Episoden, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Hauptstrang der Handlung stehen, und beschränken sich auf je ein Thema. «Üebig im Gländ» soll im Folgenden als Beispiel eines modernen Hörspiels dieses Typus interpretiert werden. In «Rio Mapiri» werden drei junge Abenteurer im bolivianischen Berg-Urwald mit der Gottheit eines Indiostammes konfrontiert, deren Erscheinen zuvor schon einen Wissenschaftler den Verstand gekostet hat. Die sechste Folge, die in einem Höhlensystem der Kurfirsten spielt, erinnert in der Anlage wie die zweite an das 1924 von der BBC gesendete, vermutlich erste Hörspiel überhaupt, das durch das Dunkel untertag seelische Energien der Hörer zu mobilisieren versuchte. In «Wassergäng» entdeckt eine Gruppe junger Forscher eine bizarre Statue, welche sie mit übernatürlichen Kräften in Verbindung bringt, von denen Hirtensagen der Gegend erzählen. Ausser der im Ausland spielenden dritten und fünften Folge sind die Hörspiele der Serie alle in Dialekt geschrieben.
Zur Klärung der Frage, wie sich Annemarie und Hans Peter Treichlers Serie «Die tausendundzweite Nacht» an die Tradition der «unheimlichen Geschichten» anschliesst und inwiefern sie mit dieser bricht, soll nun die nach einem Jahr Pause gesendete vierte Folge mit dem Titel «Üebig im Gländ» genauer untersucht werden. Dass man mit dieser episodischen Folge von Hörspielen bewusst an das «Rezept» der «Fährima»-Reihe anknüpfen wollte, wurde im Programmbulletin ausdrücklich erwähnt.19 Deutlicher noch als bei der Vorläufer-Serie wies der Titel auf märchenhafte Anklänge hin. Hans Peter Treichler, der als promovierter Germanist mit spätmittelalterlicher Unterhaltungsliteratur bestens vertraut war und sich mit seinen zur Gitarre vorgetragenen «Rauf-, Sauf- und Liebesliedern» einen Namen gemacht hatte, war sich der Nähe zum Trivialen bewusst, liess aber auch in seiner Auffassung, «dass wir da eine Lücke füllen zwischen Kunst und Unterhaltung»20, seine etwas höheren Ansprüche durchscheinen. Der Charakter der Serie ist mit dem Begriff der «kultivierten Unterhaltung», in der wie in vielen Kriminalhörspielen «Elemente der trivialen Spannung und solche einer psychologischen Vertiefung» konvergieren21, am besten zu fassen. Dem Manuskript zu «Üebig im Gländ» sind informative «Anmerkungen zur Inszenierung» von Hans Peter Treichler vorangestellt. Daraus wird ersichtlich, dass etwa die Musik nebst ihrer Funktion als trennendes Element zwischen einzelnen Szenen wie in früheren Tagen zur Akzentuierung von Pointen verwendet werden sollte. Als «Geräuschkisten» nach bewährtem Vorbild standen die sechs Folgen etwas abseits der in den siebziger Jahren vorherrschenden dramaturgischen Norm. Geräusche sind die bevorzugte Form, in der sich die übernatürlichen Kräfte manifestieren. Wenn einer der Soldaten seine Kameraden zur Ruhe anhält:
«Eschenmoser: Still!
(Nähe Tür Ritzen und Klirren, auf Glas, Klirren von Scherben.)
Eschenmoser: Biss doch still! Los etz!» (S.11)
dann wird damit die dramaturgische Relevanz des Geräuschs unterstrichen. Nebst den leitmotivisch auftretenden Glasgeräuschen macht sich das Gespenst auch in Schritten, in einem seltsamen Schwirren, im Schleifen eines Korbes, im «Galopp» eines vibrierenden Bettes und im Klappern eines Fensterladens bemerkbar. Aber auch dem anhaltenden Regen ist über die «Rolle eines blossen Hintergrundgeräusches» hinaus eine «stimmungsbildende Funktion» zugedacht: «So wie er an den Soldaten zehrt, ihre Widerstandskraft auswäscht und Einzelne in Rage versetzt […], muss er auch die Nerven des Hörers strapazieren, ihm ein Gefühl der Kälte und des Unbehaustseins suggerieren.» (S.3)
«Üebig im Gländ» ist im Unterschied zu den ersten drei Folgen nicht nach dem Prinzip des Rahmenhörspiels mit Episoden gebaut, sondern präsentiert sich als ein dramatisches Hörspiel, dessen Handlung sich kontinuierlich über fast eine Woche hinzieht und an mehreren Orten spielt. Obwohl es kürzer ausfiel als die vorhergehenden Produktionen, ist der Vorwurf nicht unberechtigt, der Spuk mache sich «von allem Anfang an zu handfest bemerkbar» und erfahre «erst nach vielen Wiederholungen eine letzte Steigerung.»22 Da hilft auch die psychologische Motivation nicht, dass die Soldaten mit zunehmenden körperlichen Strapazen weniger empfänglich sind für unheimliche Erscheinungen, die sich deshalb immer geräuschvoller manifestieren müssen. Durch zu starke stoffliche Dehnung ist das Genre offensichtlich rasch überfordert. Abgesehen von Zügen einer Exposition im Dialog der ersten Szene, welcher bereits Geschehenes andeutet, führt die Handlung nach der Art des Zieldramas geradlinig zur Katastrophe des Schlusses hin. Einer Gruppe von WK-Soldaten, die am Sonntagabend aus dem Urlaub zurückkehren, bietet sich in der Unterkunft ihrer Einheit, einer umgebauten Alphütte, ein unheimliches Spektakel: Auf dem Dach sind Schritte zu vernehmen, in der Nähe der Türe und Sekundenbruchteile danach am andern Ende des Raumes hört man im Dunkeln Ritzen auf Glas und Klirren.
Die Erscheinungen häufen sich im Laufe der folgenden Tage und nehmen so massive Formen an, dass auch der Leutnant, der sich gegenüber den gleichaltrigen Untergebenen mehr schlecht als recht durch Sachlichkeit und Rationalität behauptet, nicht mehr darüber hinwegsehen kann; «seine Autorität» – so erläutert die Regieanweisung – «ist durch die unerklärlichen Ereignisse auf vage Art in Frage gestellt.» (S.30) Der zu Hilfe gerufene Fachmann, ein Psychologe im Grad eines Oberleutnants, rückt dem Spuk mit parapsychologischen Begriffen zu Leibe. Seine Feststellung, dass es sich um in der Fachliteratur bekannte sekundäre Erscheinungen handle, die sich auf eine Hauptursache zurückführen lassen müssten, kann aber die Unruhe in der Mannschaft nicht dämpfen. Der geregelte Dienstbetrieb scheint durch mehrere Akte der Insubordination gefährdet. Aus der Erzählung eines Einheimischen in der Dorfkneipe erfahren die Soldaten, welche Ursache all den seltsamen Phänomenen zugrunde liegt. Die Sage berichtet von einem Zusenn, der vor mehr als einem halben Jahrhundert von einer Rüfe (Erd- und Steinlawine) in der Hütte, die an der Stelle des Militär-Kantonnements stand, eingeschlossen worden war und an Hunger und Durst starb, da er nicht rechtzeitig entdeckt wurde. Mit dem Schnaps seiner Kameraden, der im Dachboden versteckt war, hätte er sich retten können, wenn er davon gewusst hätte. Hinweise auf das bevorstehende erneute Niedergehen der Rüfe werden von den Wehrmännern zu spät erkannt. Das Spiel endet mit dem Rumpeln des Erdrutsches. Einer der Soldaten ist noch draussen.
Was diese neue Form der «unheimlichen Geschichten» am deutlichsten von den «Fährima»-Hörspielen unterscheidet, ist das Fehlen jeglicher Ironie. War dort ein Augenzwinkern schon im Titel nicht zu übersehen, so zielt hier alles darauf ab, die Fiktion als Realität erscheinen zu lassen. Die Soldaten werden durch die Spukerscheinungen «massiv eingeschüchtert», was sie vorerst durch grössere Aggressivität kompensieren. (S.18) In einer der Regieanweisungen, die weit über das übliche Mass an Erläuterung zur Situation hinausgehen und eigentliche Hinweise zur Interpretation liefern, ist ausgesprochen, worum es in dem Hörspiel letztlich und ausschliesslich geht: um das Hervorrufen von «Angst und Schrecken». (S.18) Diesem Ziel dient vor allem der Schluss, der alle Sicherheit, die sich aus parapsychologischen Deutungsversuchen und aus dem Aufdecken sinnvoller Bezüge durch die Erzählung der Dorfbewohner ergeben hat, als Schein deklariert und mit der Katastrophe wegwischt.
Das Hörspiel endet wie die Sage in Schutt und Asche. Darin unterscheidet es sich grundsätzlich vom Typus des Kriminalhörspiels, mit dem es durch das Element der Spannung verbunden ist. Das Hörspiel der Geschwister Treichler gibt sich um einiges «härter» als die «Fährima»-Geschichten, deren Pointen zwar Betroffenheit, danach aber auch ein befreites Aufatmen auslösten, da sie Hinweise auf die Unwirklichkeit des Geschehens mitvermittelten. Wenn das Hörspiel «Üebig im Gländ» aufzeigt, dass eine straffe hierarchische Ordnung, wie sie das Militär repräsentiert, durch Einwirkung übernatürlicher Kräfte gefährdet wird und sich rasch aufzulösen beginnt, dann führt dies bereits über die primär unterhaltende Zweckbestimmung der Reihe hinaus. Diese verkennt der Verfasser einer Kritik, der bedauert, «dass die schöne, anscheinend vom Hasliberg stammende Alpensage nur als vordergründige Spukgeschichte präsentiert wird, wo sie doch die Möglichkeit geboten hätte, zwei Erlebnisebenen, eine reale und eine mythische, kunstvoll gegeneinander auszuspielen und ineinander übergehen zu lassen.»3223 Damit wäre eben ein ganz anderes Hörspiel entstanden, das dem klar definierten realistischen Konzept der Reihe «Die tausendundzweite Nacht» nicht entsprochen hätte.
Auch der Vorwurf, «der realen Handlungsebene des Soldatenalltags» fehle es «trotz bewusst rau gehaltenen Dialogen an Atmosphäre»24, trifft daneben. Die richtungweisende Inszenierung von Hanspeter Gschwends Stereo-Hörspiel «Feldgraue Scheiben» (1971) kann hier nur bedingt als Massstab angelegt werden, da der Realismus dieses Hörspiels ganz anderen Zwecken dient. Bei Gschwend soll die fiktionale Gestaltung und Vermittlung von Realität als Realität Betroffenheit über diese Realität hervorrufen, die das Thema des Hörspiels ist. Im Hörspiel der Geschwister Treichler hat die realistische Gestaltung des Soldatenalltags die Aufgabe, das Spukgeschehen zu kontrastieren und damit zu akzentuieren. Sie ist dem unterhaltenden Zweck untergeordnet. Zwar nutzt auch «Üebig im Gländ» auch die naturalistischen Möglichkeiten der Stereo-Technik durch bewusste Positionierung der Stimmen im Raum, die sogar durch eine Skizze festgelegt wird (S.8), doch bildet dieses Hörspiel die Realität des Soldatenalltags vorwiegend mit sprachlichen Mitteln nach.
So weit wie diese «unheimliche Geschichte» war in der konsequenten Imitation von Umgangssprache zuvor erst Hugo Loetscher in seinen Dialektsatiren «Dia-Aabig» (1975) und «D’Bschärig» (1977) gegangen. Dass die Häufung grober Flüche und ordinärer Ausdrücke, welche unabdingbar zum Soziolekt von Schweizer Wehrmännern gehören, zu Protesten von Seiten einzelner Hörerinnen und Hörer führen würde, war unter anderem von Loetschers Hörspielen her bekannt und wurde von den verantwortlichen Mitarbeitern von Studio Basel offenbar In Kauf genommen. Weniger ohrenfällig war die konsequente Beachtung von Eigenheiten der Umgangssprache, welche das Manuskript in einer detaillierten Orthographie festschrieb. Die «Anmerkungen zur Inszenierung» betonen, dem Schauspieler sei «immer wieder einzuimpfen, dass jede Zeile so tönen muss, wie er sie draussen auf der Strasse und in der Kneipe zu hören bekäme.» (S.1) Die Abweichungen der Alltagssprache von der «gepflegten» Mundart, auf welche Hans Peter Treichler schon in diesem Hörspiel grössten Wert legte, – genannt werden in den «Anmerkungen» Verschleifungen, Idiosynkrasien (individuelle, keinen allgemeinen Regeln folgende Ausdrücke), alogische Syntax und Grammatik sowie häufiges Unterbrechen und Ins-Wort-fallen –, gehören zu den Eigenheiten des modernen Mundarthörspiels, das sich schon in den sechziger Jahren in einzelnen Produktionen vom traditionellen Mundarthörspiel im Gefolge der Heimatschutzbewegung zu emanzipieren begonnen hatte. Als Beispiel für den sprachlichen Realismus dieses Hörspiels sei eine längere Passage aus der ersten Szene zitiert:
«Reiter: Du, de Zurflueh heb föif Tag Scharfe-n-oder was? Hockt de immer na? Da obe?
Egli: Du, die händ jeeni (jede Menge) Schlääg daobe. Isch natüürli sälber gschuld, wän-er em Blanchard eis uf tSchnure gitt.
Reiter: Emm Blanchard wüürt-mi aso nöd getroue. So-m-en-uuhuere Fätze.
Egii: De Blanchard hett en eifach zämegschisse… hett en, oder, und dänn hett’s es gha. Wän-er em käni tätscht hett…
Reiter: Du, ’ch stiig glilch nöd. de Zurflueh hät eifach drü…
Egli: Oder, ’s händ en alli gsee, vom Näst uus. De hät i sim Züüg umenandggnuuschet, gseet warschindli die zwei Fläsche, oder, und schüüsst’s eifach an Bode. Du, s’mues inn gsi si. Die andere sind all scho im Näst ggläge.
Reiter: Was für Fläsche?
Egli: So Fläsche. De Zurflueh hät taa we-n-en Sibesiech, er chänn nüüt defür, gsääch die Fläsche stah ufem Gstell, nimmt’s i tHand, und dänn heb em’s eine zur Hand uus gschlage.
Reiter: Chommetz. Wär?
Egli: Spinnt doch, chomm. ’sch überhaupt niemert gstande da, ussert imm. Chunnt de Blanchard zurTüre-n-ie und gseet die Schärbe-n-am Bode… Frääged er z’eersch na ruig, ganz ruig, oder. Verzellt de Zurflueh so-n-en Seich. Und wo-n-er’s emm nöd gglaubt hät, hät er em eifach voll eini ppached.
Reiter: Mach mi nöd färtig.
Egli: Doch. Wänn de Blanchard nöd so-n-en liebe Siech wär, hett er…
Reiter: Föif Tag Loch, chomm.
Egli: Nu will’s de Läffzgi gghöört hät, susch doch nöd. De Zurflueh voll bis am Schluss de Lööli ggmacht: Er chänn nüüt defür, ’s seged alles Schafseckel, debii händ-en drüü gsee stah und im Züüg umenuusche.
(Schon seit einiger Zeit Gläserklirren, Rattern etc. des Getränketrolleys. Jetzt lauter.)» (S.5 f)
Wer diese Passage zum ersten Mal hört, wird Mühe haben, die Zusammenhänge zu erfassen. Daran tragen Ellipsen und abgerissene Dialogfetzen die geringste Schuld. Vielmehr liegt es an der Position des sozusagen unbeteiligten, aussenstehenden Lauschers, welche den Zuhörenden zugedacht ist. Sie befinden sich in einer noch ungünstigeren Lage als der Soldat Reiter, der die örtlichen Verhältnisse kennt und über das Vorgefallene wenigstens teilweise informiert ist. Aus den höchst fragmentarischen Auskünften seines Kameraden Egli kann er sich, wenn auch mit Mühe, ein Bild machen. Die Zuhörenden werden erst später, wenn sie selbst mit dem Gespenst konfrontiert werden, das mit Klirren und Glasritzen sein Unwesen treibt, erfassen können, weshalb es wegen zwei Flaschen zu einer so heftigen Auseinandersetzung zwischen Blanchard und Zurfluh kommen konnte. Auch die Streitenden ahnten ja nicht, dass höhere Mächte im Spiel waren, als die beiden Flaschen in Brüche gingen. Und selbst Egli und Reiter wissen über die wahre Ursache des Aufruhrs noch nicht Bescheid.
Dass sich in den klirrenden Gläsern des Getränketrolleys bereits leitmotivisch unter der Alltagsszene die Ebene des Unheimlichen akustisch ankündigt, dürfte zu diesem Zeitpunkt noch kaum erfasst werden. Die Zuhörenden werden also auf quasi-dokumentarische Weise an das Spiel herangeführt und wachsen mit den betroffenen Soldaten allmählich ins Geschehen hinein. Sie haben keinen Vorsprung vor den Protagonisten, werden nicht etwa durch einen allwissenden Erzähler geführt, sondern können sich nur auf ihre akustische Wahrnehmung verlassen, die stellenweise durch die scheinbar auf Aussenstehende nicht Rücksicht nehmenden Dialoge erschwert wird. In solchen Passagen ist es ratsam, seinen Ohren zu trauen und, da man es ja mit einem Spiel zu tun hat, auch im bloss Angetönten oder Unausgesprochenen einen Sinn zu vermuten. Das unterhaltende Hörspiel wird so zu einer Art Hör-Schule. Hans Peter Treichler hat die beschriebene Technik in späteren Arbeiten wieder aufgenommen und weiterentwickelt, in denen es nun nicht mehr darum ging, Angst und Schrecken zu erzeugen, sondern Einsichten in psychologische und soziale Zusammenhänge des Alltagslebens zu ermöglichen. Am vollkommensten ist dies in der Produktion «De Hundstag» (1984) verwirklicht.
Ein dem handfesten Realismus der Dialoge entgegengesetztes Element besteht in der Typisierung der Figuren, deren Verhalten und Charaktereigenschaften teils zuhanden der Regie definiert bzw. psychologisch gedeutet werden. So heisst es etwa als Anweisung zur zweiten Szene:
«Der Taxifahrer Affolter und der Telefonmonteur Klimm haben in früheren Diensttagen je die Rolle des Kompagniekalbes gehalten; jetzt, da der Dienstbetrieb sie in den gleichen Zug versetzt hat, stehen sie sich mit etwas eingeschüchterter Animosität gegenüber. Beide lachen gern als erste über die eigenen Spässe; aus gezwungener Solidarität heraus auch immer laut über die faulen Witze des “Gegners“. – Goldmanns Schweigsamkeit entspringt dem Wunsch, man möchte seinen Gefreitenrang bitte übersehen und ihn als “one of the boys“ akzeptieren, während die Zurückhaltung des ETH-Studenten Eschenmoser eher damit zu tun hat, dass er in der Gruppen-Hackordnung ohnehin zuoberst steht und diese Position nur im Notfall betonen will.» (S.7 f)
Für die Rolle des Leutnants wird vorgeschrieben, dass sie in einem «trocken-verbindlichen Ton» gesprochen wird und darstellen soll, «dass er den engen Kontakt mit der Truppe, den die abgelegene Alp bedingt, eher fürchtet: Seine Autorität steht auf wackligen Füssen, und die Truppe nimmt ihm weder die joviale “Unter-uns“-Masche noch die Harte-Kämpfer-Pose ab.» (S.13 f) Im Unterschied zum Leutnant in Gschwends Hörspiel, dessen innerer Konflikt und Wandlung den Kern der Handlung ausmachen, verändert sich die Figur im unterhaltenden Hörspiel der Geschwister Treichler nicht. Gegen Ende, als eine neue Einstellung gegenüber dem Spuk sich als unumgänglich erweist, wird sie einfach durch die Figur des Oberleutnants ersetzt. Auch die Soldaten werden zwar müde von den Anstrengungen, sie reagieren erschrocken und verlieren zum Teil ihre Selbstbeherrschung, aber sie sind «nicht innerlich betroffen» und erleben «keine echte Begegnung mit den Urkräften der Natur», wie der Kritiker feststellt. Verfehlt ist es nur, dem Hörspiel daraus einen Vorwurf zu machen. Auch die Sage lässt es in der Regel beim Grauen der Überlebenden bewenden. Einer inneren Wandlung bedarf es nicht. Die Typisierung der Charaktere bezweckt hier weder Verspottung noch Idealisierung, sondern dient wie der sprachliche Realismus der Betonung des Unheimlichen, welches das Hauptthema des Hörspiels ist.
50 Jahre «Schreckmümpfeli»
Man könnte die «unheimlichen Geschichten» der Geschwister Treichler, die sich offensichtlich stark am Stil der Sage orientieren, als einen anachronistischen Versuch werten, ein unterhaltendes Genre bloss stofflich zu aktualisieren und in eine Zeit hinüberzuretten, die nicht mehr an die wie auch immer parapsychologisch motivierte Erscheinung von Geistern der Ahnen glaubt. Eine solche Kritik mag zum Teil berechtigt sein, übersieht aber, dass die Neuauflage der «unheimlichen Geschichten» Ende der siebziger Jahre immerhin eine Lücke im Hörspielprogramm schloss, indem sie unterhaltende Beiträge von beachtlicher Qualität hervorbrachte. Wichtiger aber ist, dass diese Serie als «Werkstatt» diente, aus der eine grössere Zahl anspruchsvollerer Produktionen hervorgegangen ist: Annemarie Treichler hat nebst einem Kurzhörspiel noch zwei grössere Arbeiten geschrieben, und von Hans Peter Treichler wurden bis 1990 nicht weniger als acht weitere Werke produziert, die teils zum Besten gehören, was an Vergleichbarem in den achtziger Jahren gesendet wurde.
Ähnlich wie im Bereich des Kriminalhörspiels ist auch bei den «unheimlichen Geschichten» ein ironisches Nachspiel zu beobachten. In seinem zweiten Hörspiel «Come back Dracula» (1986) versammelt Norbert Loacker in gegenwärtiger Zeit auf Schloss Dracula in Transsilvanien nicht nur Figuren aus Bram Stokers Roman, sondern auch den Autor selbst nebst Zeitgenossen des 20. Jahrhunderts zu einem Kongress, welcher der psychologischen Interpretation und Demontage des Schauerromans dient. Stokers fiktive Gestalten sollen sich selbst als Produkte ihrer Zeit begreifen lernen und nach Wegen suchen, wie mit dem real existierenden Bösen in der heutigen Welt, das in Form von Atomsprengköpfen im Keller des Schlosses lagert, umzugehen wäre. Gruseleffekte, welche das Wesen der «unheimlichen Geschichten» ausmachten, werden von Einsichten über das Grauen des möglichen atomaren Holocaust abgelöst. Loackers Hörspiel ist eine Parodie des Genres, die einer Zeit entspricht, welche der Science-Fiction eher zugetan ist als Geistererscheinungen, blutsaugenden Vampiren und parapsychologischem Tischerücken.
In einer Reihe von Kurzhörspielen von Kurt Hutterli lebte zwölf Jahre nach der Serie von Annemarie und Hans Peter Treichler das Thema in einem neuen, der Zeit entsprechenden Format wieder auf. In den einzelnen Folgen von «Oberassistent Märki» (1991, 12 Folgen) geht ein Wissenschaftler, der an einem Buch mit dem Arbeitstitel «Schweizer Geister- und Spukgeschichten» arbeitet, übernatürlichen Erscheinungen in ihrem soziokulturellen Umfeld nach, über die ihm Radiohörer aus allen Gegenden des Landes berichtet haben. Neu ist vor allem die während der achtziger Jahre entwickelte Form der episodischen Reihe von Kurzhörspielen, die in Sendegefässen mit hohen Einschaltquoten, in diesem Fall im «Rendez-vous am Mittag» auf der ersten Senderkette, platziert wurden. Darin zeigt sich, dass Hörspiele vom Typus der «unheimlichen Geschichten» nicht unbedingt als passé gelten müssen.
Überlebt hat das Gruseln bis heute im Format des «Schreckmümpfeli», einer episodischen Reihe von kurzen Gutenacht-Geschichten für Erwachsene von sechs bis zwölf Minuten Spieldauer, deren Schreckmoment nicht nur aus «Moritaten»25 und katastrophalen Ereignissen, sondern mitunter auch aus unheimlichen Szenarien resultiert. «Geschichten, die Spannung aufbauen und ein überraschendes Ende finden»26 – das ist der gemeinsame Nenner. Die Sendreihe kann sich vorübergehend auch ganz auf Spuk- und Geistergeschichten konzentrieren, von denen es angeblich «in der Schweiz wimmelt». So war in einer Sondersendung anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums 2015 etwa die «Weisse Frau», die im Belchen-Tunnel spukt, Thema einer Reportage. Das Team der Hörspielmacher traf vor Ort «Menschen, die mit der Spukgestalt in Berührung gekommen sind» und machte sich auch «auf den Weg zur 800-jährigen Linde bei Linn AG, unter der sich Unheimliches zugetragen haben soll», und als Experte wurde der «Leiter der Beratungsstelle für Parapsychologie in Freiburg im Breisgau» interviewt. Das alles hat – nebst der formalen Kürze – Ähnlichkeit mit den soziokulturellen Recherchen von Hutterlis Oberassistent Märki, der während einer langen Sendepause des «Schreckmümpfeli» auftrat. Dieses hatte 1975 Premiere und wurde 1989 – man weiss heute nicht mehr genau, warum – für dreizehn Jahre ausgesetzt, möglicherweise, um finanzielle Mittel für die damals boomende «Maloney»-Serie freizumachen. 2002 suchte man «etwas Fiktionales für die Nacht»27 und hielt die episodische Serie, die jeweils am Montagabend nach 23 Uhr ausgestrahlt wird, wiederum für zeitgemäss. Vielleicht sollte man dafür besser «zeitlos gültig» einsetzen, da die «Kult»-Serie seither ohne weitere Unterbrechung bis heute gesendet wird. Ein Teil der Produktionen ist auf Compact-Discs im Handel erhältlich, worin sich der Erfolg auch kommerziell ausdrückt. Und die vollständige Sammlung von fast 700 Produktionen wird von Radio SRF 1 via Podcast kostenlos zur Verfügung gestellt.
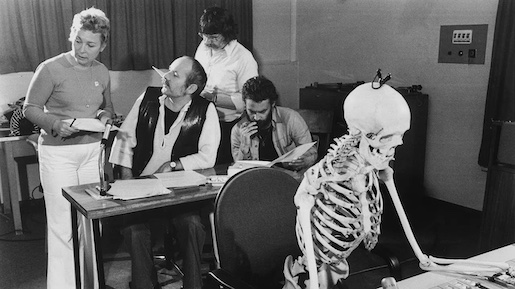
Seine fünfzigjährige Tradition – entsprechend der Hälfte der bisherigen Hörspielgeschichte – macht das «Schreckmümpfeli» zu einer Hörspiel-Konstanten. Diese Eigenschaft teilt es mit der «Maloney»-Kultkrimi-Serie, die sich in der durchschnittlich doppelten Länge der Folgen und im Hinblick auf Struktur und inhaltliche Konstanz stark von den heterogenen Gutenacht-Kurzhörspielen unterscheidet. Diese sind beim SRF-1-Stammpublikum offensichtlich bis heute beliebt. Die Gründe für dessen Präferenzen liessen sich zuverlässig nur durch eine empirische Studie ermitteln. Von Interesse wäre auch, genauer zu wissen, welche Erwägungen 2002 zur Wiederaufnahme der Produktion führten. Da solche Grundlagen für eine pragmatische Analyse fehlen, muss ich mich auf die immanente Methode verlegen und Gründe für den anhaltenden Erfolg der Serie vor allem aus Form und Inhalt der Beiträge ableiten. Ich gehe von der Hypothese aus, dass 1. die Regelmässigkeit der Ausstrahlung, 2. die Kürze und – damit zusammenhängend – 3. die Geradlinigkeit der Geschichten ohne Happy Ending die ausserordentliche Beliebtheit dieser „Kult“-Produkte ausmachen.
Die «Fährima»-Hörspiele und die unheimlichen Geschichten der «tausendundzweiten Nacht» wurden in unregelmässigen Abständen von mehreren Monaten bis zu einem Jahr gesendet. Der Serientitel, die einheitliche Machart und nicht zuletzt die eingängige musikalische Umrahmung sind unveränderliche Markenzeichen, die der Identifikation dienen. Das gilt auch für die «Schreckmümpfeli»-Produktion, die nun aber zum ersten Mal Kurz-Hörspiele in kurzem Abstand von einer Woche während Jahren und Jahrzehnten regelmässig zu Gehör brachte. Das musikalische Signet beschreibt Sabine Bär-Graf so:
«Laut schlägt ein Herz, ein rauher Wind verkündet Unheil, eine singende Säge quietscht Johannes Brahms‘ Wiegendlied: Das ist das Schreckmümpfeli-Signet, auf das Herr und Frau Schweizer wöchentlich warten. Für jede Produktion eigens eingelesen und immer mit anderem Titel aber stets mit gleicher Musik: der Kenner weiss sogleicht, welch Grusel ihm blüht.»28
Konstant war während dreissig Jahren auch die Stimme des Präsentators Rainer Zur Linde, der nach seinem Tod 2015 von Samuel Streiff abgelöst wurde. Der Konsum wird damit zu einer wohltuenden Gewohnheit, die wenig Hör-Aufwand erfordert. Die Produzierenden gehen von «Neid und Hass, Eifersucht und Gier, Rache und Machtstreben» als wenig salonfähigen Motiven für die Rezeption aus und scheinen ihrerseits glücklich zu sein, dass sie ihrer Phantasie für einmal nicht die Zügel der Political Correctness anlegen müssen. Selbst mit den ehernen Gesetzen des Kriminalgenres darf gebrochen werden, indem etwa «ein Hund oder ein Spannteppich zum Mörder werden oder Tod und Teufel in Person mitmischen.»29 Der überschaubare, relativ stereotype Verlauf der Geschichten befriedigt angestammte Erwartungen restlos, ohne den Rezipierenden einen Horizontwandel abzuverlangen. Der katastrophale Ausgang gehört zum erwarteten Konzept und stört deshalb nicht. Er entspricht sogar der heutigen Lebensrealität besser als der oft utopische Märchenschluss oder die obligate «Katharsis» am Ende des Kriminalhörspiels, die dem moralisch Guten zum Sieg verhelfen. Man ist dem schauerlichen Geschehen hilflos ausgeliefert, und die Situation wird durch keine heldenhafte Tat gerettet. Allerdings ist dabei den Zuhörenden jederzeit klar, dass es eine frei erfundene, fiktive Katastrophe ist, der man schaudernd unter der Bettdecke lauschen darf, ein Erlebnis, das uns minutenlang von unseren eigenen, realen Problemen ablenkt, bevor wir am nächsten Morgen wieder in unser «bürgerliches Heldenleben» (Sternheim) zurückkehren.
Prä- oder postheroisch? Die Frage erübrigt sich: Sagen gab es immer seit Menschengedenken, und auf dieses Stoff-Reservoir greift ein Teil der «Schreckmümpfeli»-Produktion wie ihre Vorläufer-Formate zurück. Die andere Hauptquelle sind durchaus diesseitige Sensationsberichte, wie sie etwa in Moritat und Bänkelsang seit dem späten Mittelalter kolportiert wurden und heute in traditionellen und neuen, «sozialen» Medien zirkulieren. Auch literarische Vorbilder gibt es in grosser Zahl, man denke nur an den Geist von Hamlets Vater oder an «Cardenio und Celinde» und «Das verliebte Gespenst» von Andreas Gryphius. Die moderne, aufgeklärte Gespenster-Literatur beginnt mit Daniel Defoe und hat Werke von Horace Walpole, E. T. A. Hoffmann, Heinrich von Kleist, Heinrich Heine, Charles Dickens, Nikolai Gogol, Oscar Wilde, Stephen King und vielen anderen Berühmtheiten vorzuweisen. Aus solchen Quellen schöpfen aber eher die Langformen der «Fährima»-Geschichten, zum Beispiel in der Hörspiel-Adaption einer Erzählung von Edgar Allan Poe. Bram Stokers Vampir-Roman wird von Norbert Loacker in seiner Persiflage «Come back Dracula» modernisiert und ironisch aufbereitet. Die Faszination unheimlicher und unerklärlicher Geschichten ist also keineswegs neu, und schon die lange Tradition auf allen Qualitätsstufen der Literatur hilft den Erfolg von Hörspielen dieses Typus, insbesondere auch der endlosen Reihe der «Schreckmümpfeli»-Hörspots, ein Stückweit zu erklären.
- vgl. Pgr 2/86, S.13 ↩︎
- E.B., «Der Blick hinüber» – ein Hörspiel um die Grenzen des Irrationalen, in: SRZ 15/40 ↩︎
- vgl. etwa die dreiteilige Reihe «Märchen für Erwachsene» (1943), in deren Rahmen von Alfred Fankhauser «Kumali», von Heinrich Lämmlin «Der letzte Wunsch» und von Konrad Murbach «Die drei Ringe» produziert und gesendet wurden. ↩︎
- vgl. Lüthi, Max, Es war einmal… Vom Wesen des Volksmärchens…, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 5/1977, S.5 und S.19 ↩︎
- Appenzeller, H., Neues Märchenspiel von Fritz Gafner am Radio. «Gsprööch mit de Schlange», in: Neue Zürcher Nachrichten, 30.3.84 ↩︎
- vgl. Lüthi, 1977, S.59 ↩︎
- ib., S.56 ↩︎
- pr., Wiederholung der über 25jährigen Hörspielserie «Verzell du das em Fährima!» auf Radio DRS 1. Das ist Radio – das war Radio, in: Der Bund, 19.7.86 ↩︎
- Anonym, Zwei Geschwister lassen spuken, in: tvrz 48/77, S.49 ↩︎
- vgl. Faulstich, Werner, Radiotheorie. Eine Studie zum Hörspiel «The War of the Worlds» (1938) von Orson Welles, Tübingen (Narr) 1981, S.33 ↩︎
- Kaufmann, P. A., Sommerliche Hörspiel-Reprisen: Sechs Fährima-Geschichten, in: Solothurner AZ, 5.7.86 ↩︎
- Reck, D., «Verzell du das em Fährima!» in: Basler Zeitung, 19.7.86 ↩︎
- Stickelberger, M.-L., Gruseln – zum zweiten, in: TA, 17.7.86 ↩︎
- pr., a.a.O. ↩︎
- vgl. Schneider, H., ’s geischteret in dr Ruetegass, in r+f 1/67, S.45 ↩︎
- zur Unterscheidung zwischen «episodischem» und «integriertem Fortsetzungshörwerk» vgl. Frank, Armin P., Das Hörspiel. Vergleichende Beschreibung und Analyse einer neuen Kunstform, durchgeführt an amerikanischen, deutschen, englischen und französischen Texten, Heidelberg (Winter) 1963, S.20 ↩︎
- Schneider, a.a.O. ↩︎
- Ein Bezug zu Joseph Roths gleichnamigem Roman oder ähnlichen Werken anderer Autoren ist nicht erkennbar. ↩︎
- vgl. Pgr 3/77, S.11 ↩︎
- Anonym, Zwei Geschwister lassen spuken, in: tvrz 48/77, S.49; vgl. auch Boije, M., Auf den Spuren der Vaganten. Begegnung mit Hans-Peter Treichler, in: tvrz 16/72, S.74 f ↩︎
- wg., Hörspiel «Üebig im Gländ», in: NZZ, 10.2.79 ↩︎
- ib. ↩︎
- ib. ↩︎
- ib. ↩︎
- Die Reihe wird von den Machern gelegentlich als «Kultkrimi»-Serie bezeichnet, doch schon aufgrund der Kürze der Beiträge ist eine eigentliche Kriminalhandlung mit Verwicklungen und Detektion nicht möglich. ↩︎
- Mittelland-Zeitung, zit. nach Wikipedia ↩︎
- zit. nach Auskunft von Johannes Mayr, Hörspiel SRF, vom 11.8.2025 ↩︎
- Bär-Graf, Sabine, «Schreckmümpfeli»: Krimi-Kurzhörspiel mit Kultstatus, srf.ch 9.9.2020 ↩︎
- ib. ↩︎
