Der Streit um die Gotthelf-Hörspielserien und die Folgen
Die äusserst populären zürichdeutschen family serials der vierziger und fünfziger Jahre waren original. Ihre Erfinder und Entwickler – Arthur Welti, Albert Rösler, Max Werner Lenz, Emil Hegetschweiler und Schaggi (Jakob) Streuli – waren frei in der Gestaltung ihrer Inhalte und konnten sich ungehemmt an den Wünschen ihres Zielpublikums orientieren. Basel begann erst 1953 mit der Produktion vielteiliger Dialektserien unter dem sprechenden Titel «Vor hundert Jahren. Ein Familienschicksal aus dem alten Basel» (ab 1953) von Gertrud Lendorff. Hans Hausmann, Albert Werner und Rainer Litten begründeten mit ihrer in Wiederholungen bis in die achtziger Jahre erfolgreichen Serie «Verzell du das em Fährima!» (ab 1958) die Tradition der «unheimlichen und unerklärlichen Geschichten» (Untertitel).
Einen anderen Weg gingen die Dramaturgen des Berner Studios, wo man sich von Anfang an auf die Sendespiel-Adaption literarischer Werke konzentriert hatte. Vom Publikum des riesigen ländlichen Einzugsgebiets konnte man mit Sicherheit annehmen, dass der Emmentaler Dichter Albert Bitzius alias Jeremias Gotthelf (1797-1854) gut aufgenommen würde. Eine Spannung, die für das Hörspielschaffen in der deutschen Schweiz während der ganzen Nachkriegszeit bis zum Beginn der «Abteilungs»-Periode um 1965 bestimmend war, entlud sich im Gotthelf-Streit der Jahre 1953 bis 1955: der Antagonismus zwischen dem vornehmlich unterhaltenden Dialekthörspiel und dem literarisch ambitionierten Hörspiel in hochdeutscher Sprache, zwischen U- und E-Hörspiel, wie man in Entsprechung zur Musik-Szene sagen könnte. Vordergründig betrachtet, ging es zunächst nur um die Frage, ob und wie die Werke eines Dichters wie Jeremias Gotthelf für das Radio adaptiert werden können. Der Verlauf der Auseinandersetzung soll hier nur grob skizziert, dafür aber in einen grösseren Rahmen gestellt werden.

Dass die Berner Radiogenossenschaft schon im ersten Jahr ihres Bestehens eine Gotthelf-Erzählung («Michels Brautschau», 13.12.26) in ihr Programm aufnahm, vermag kaum zu erstaunen. Die Form der Darbietung als Dialektlustspiel in der wohl sehr freien Bearbeitung von Eduard Kilchenmann, aufgeführt durch Laiendarsteller der Zytglogge-Gesellschaft, entsprach ganz den programmlichen Gepflogenheiten der Pionierzeit. Daran nahm damals niemand Anstoss. In dieser ersten Gotthelf-Sendung ist aber die ganze Problematik bereits angelegt, die drei Jahrzehnte später zur Debatte stand. Unvermeidlich erscheint auch, dass Gotthelf 1937 im Zuge der Geistigen Landesverteidigung als einer der «geistigen Träger der Nation» vorgestellt wurde. Kurz danach schon wurde zu Simon Gfellers 70. Geburtstag dessen Mundartstück «Geist und Geld» nach Gotthelf gesendet. Die erneute Inszenierung dieser Bearbeitung ein Jahr nach Kriegsende, nunmehr unter dem Originaltitel «Geld und Geist» (1946), live vor dem Mikrophon aufgeführt durch Mitglieder des Berner Heimatschutztheaters, bildete den Auftakt zu einer Reihe von vielteiligen Gotthelf-Hörspielserien von Ernst Balzli, die bis zum Ende der fünfziger Jahre zum Teil mehrmals wiederholt wurden: «Ueli der Chnächt» (10 Folgen, 1946/47), «Ueli der Pächter» (3 Folgen, 1947), «Anne Bäbi Jowäger» (12 Folgen, 1948/49), «Die Käserei in der Vehfreude» (10 Folgen, 1950/51).
Im Anschluss an eine Reihe von Wiederholungen («Ueli der Chnächt» 1951; «Die Käserei in der Vehfreude» und «Ueli der Pächter» 1953) erschien am 5.12.53 Im Berner Schulblatt eine Glosse des Langnauer Lehrers Hans Schmocker, der die äusserst populären Hörspielserien als «Gotthelf-Verballhornungen» bezeichnete und in ziemlich polemischer Weise schloss: «Was übrigbleibt, sind derbe Kilter- und Kühdreckanekdoten, aber wäger nicht Gotthelf.» Nicht nur an der Übertragung von Gotthelfs Texten ins Berndeutsche nahm Schmocker Anstoss, sondern auch an deren massiver Veränderung und Kürzung. Im Grunde richtete sich sein Zorn, wie aus einem weiteren Artikel von 28.8.54 hervorgeht, «gegen den Zeitgeist», der sich in der Lesefaulheit und Konsummentalität des breiten Publikums äusserte. Dagegen gaben mehrere Stimmen, die Schmocker grundsätzlich beipflichteten, zu bedenken, dass Balzlis Sendungen auch Leser für Gotthelfs Werke gewinnen könnten. Dem widersprach der Gotthelf-Kenner und -Herausgeber Walter Muschg, der in einem Zeitungsartikel, in einem kontradiktorischen Radiogespräch und schliesslich in einer ausführlichen Schrift den Standpunkt des Philologen gegen die Popularisierung Gotthelfs im Massenmedium Radio vertrat.
Die Reaktion der Hörerschaft auf den Radiodisput war enorm und gipfelte in der Parole: «Hie Volk, dort Wissenschaft.» Zum Teil äusserte sich die Empörung in unflätigen anonymen Zuschriften an Muschg, die der NZZ-Kritiker Werner Weber zu Recht scharf verurteilt. Andererseits versucht Weber aber auch zu vermitteln, indem er ein grundlegendes Missverständnis diagnostiziert: Die «Hörer von Balzlis Sendungen», so bemerkt er, «wähnten, man bestreite ihr Erlebnis. Dabei ging es gar nicht um diesen Mann und seine Sache, sondern darum, die Grenze gegenüber Gotthelf klarzulegen.»
In der sorgfältigen Analyse der Umsetzung des letzten Kapitels der «Leiden und Freuden eines Schulmeisters» zeigt Muschg überzeugend, wie durch die Dramatisierung oft die Akzente in Richtung auf Nebensächliches verschoben, das Original verflacht, verharmlost und vergröbert, ja oft sogar der Sinn ins Gegenteil verkehrt wurde. Besonders scharf kritisiert er die Übertragung von Texten, die bewusst Schriftdeutsch verfasst, wenn auch mehr oder weniger stark mundartlich gefärbt sind, in eine berndeutsche Literatursprache, wie sie für die Mundartdichtung der Gegenwart typisch war:
«Denn Balzli versuchte die Werke nicht In das eigenwillige gotthelfsche Berndeutsch umzuschreiben, sondern er transponierte sie unbedenklich in das heutige Berndeutsch, wie es bei einem modernen Heimatdichter gesprochen wird. Für einen solchen ist der Dialekt keine Fessel wie für Gotthelf, sondern ein bewusst gepflegter Schmuck. Er schwelgt in der Mundart, er lässt seine Figuren möglichst viele seltene Ausdrücke und urchige Wendungen brauchen, so dass das ganze Wörterbuch des Schweizerdeutschen am Leser vorbeizieht. So war es auch in den Gotthelf-Hörfolgen, sie wimmelten von Wörtern und Wendungen, die Gotthelf nie gebraucht. Er war aus seiner eigenen sprachlichen Atmosphäre in ein ihm fremdes Klima mundartlicher Kraftmeierei und Originalitätssucht verpflanzt. Schon allein um dieser falschen Sprache willen müssen die Radio-Bearbeitungen abgelehnt werden.»
Damit war das Übel im Kern getroffen und die Auseinandersetzung der Sache nach – aus heutiger Sicht zumindest – entschieden. Auf der Homepage des Gotthelf Zentrums Emmental sieht man den Furor des Philologen, der sich auch gegen künstlerische Illustrationen von Gotthelfs Werken richtete, heute kritisch und betont, dass Balzlis Hörspielbearbeitungen ebenso wie Franz Schnyders Verfilmungen eine enorme Popularisierung der Werke des Emmentaler Dichters bewirkt hätten. Es wird aber auch nicht verschwiegen, dass damit die falsche Vorstellung zementiert wurde, Gotthelf habe berndeutsche Mundartliteratur geschrieben.
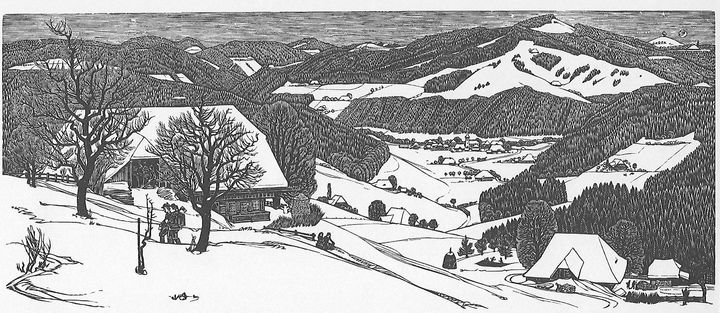
Das Schwelgen in preziöser Mundart, eine Nachwirkung der Geistigen Landesverteidigung der dreissiger und vierziger Jahre, das Muschg zu Recht kritisierte, war im Begriff des «bluemete Trögli» in den fünfziger Jahren noch durchaus positiv konnotiert. Auf diesen Punkt zielt die Kritik ab, die ab Ende der sechziger Jahre einen neuen Typus des Dialekthörspiels gegenüber dem alten Mundarthörspiel abgrenzt. Man bediente sich dazu gelegentlich des Ausdrucks «Modern Mundart». Der Dramaturg und Regisseur Joseph Scheidegger kann 1971 auf eine Reihe junger Autoren hinweisen, die sich trotz ihrer «Angst vor dem Heimatstil» an Experimente mit dem Dialekt im Hörspiel wagten. Auch der NZZ-Kritiker Martin Schlappner stellt wenig später mit Erleichterung fest, dass «das ziselierte Berndeutsch» der Gotthelf-Serien am Radio nur noch selten zu hören sei, und lobt die Arbeit von Hörspielmachern, die von den sprachkritischen Verfahrensweisen der Konkreten Poesie ausgehen. Mundart ist nach deren Auffassung «Sprachmaterial», das nach Massgabe der «schriftstellerischen Oekonomie» in eine bestimmte Form gebracht, gegliedert und bewertet wird.

Gotthelf aber hatte ab Mitte der siebziger Jahre ein erfreuliches Revival im Programm von Radio DRS: 1975 knüpfte Rudolf Stalder an der letzten Serie von Ernst Balzli aus dem Jahr 1954, der Bearbeitung der «Leiden und Freuden eines Schulmeisters», an, die von Muschg im Detail kritisiert worden war, und versuchte in einer neuen Radiofassung dieses Gotthelf-Romans die Erfahrungen aus der Kontroverse zu berücksichtigen. Sein zehnteiliger Zyklus, dessen Folgen durch lange Vorlesungen aus dem Originaltext in hochdeutscher Sprache stark episch geprägt waren, wurde damals von Publikum und Kritik gut aufgenommen. Das Berndeutsche blieb nun den zusammenfassenden Passagen vorbehalten, und die kurzen szenischen Einschübe stützten sich auf Dialoge, die schon in Gotthelfs Roman angelegt sind. Dieses Experiment wurde, allerdings in gehörigem zeitlichem Abstand, fortgesetzt: 1991 wurde «Uli der Knecht», 1992 «Uli der Pächter» in der Bearbeitung von Theres und Rudolf Stalder in je einer Serie von halbstündigen Sendungen ausgestrahlt. Gotthelf wurde spätestens damit zum Schweizer Radio-Klassiker.
Zwanzig Jahre danach schlug in einer Wiederholungsserie das Pendel wieder zurück. Nicht die stärker an Gotthelf orientierten Stalderschen Bearbeitungen wurden dem Publikum dargeboten, sondern in Aufnahmen von 1951 die mit radio-nostalgischer Patina versehenen ursprünglichen Serien von «Ueli der Knecht» und «Ueli der Pächter» in der Fassung von Ernst Balzli. Dass über deren Qualität ein heftiger Disput stattgefunden hatte, wurde in der Ankündigung nicht erwähnt und war den für die Programmierung Verantwortlichen möglicherweise nicht bekannt. Stattdessen zitierte man den pathetischen Begleittext der Schweizer Radio-Zeitung aus dem Jahr der Ursendung 1946. Ein historisches Interview mit dem damaligen Hauptdarsteller Theo Melliger vermittelt einen spannenden Eindruck von der damaligen Praxis der Live-Inszenierung (1946) und Hörspielaufnahmen (1951). Im selben Jahr 2013 wurde der neu entfachten Gotthelf-Begeisterung des Publikums weiter entsprochen mit der Wiederholung von «Geld und Geist» in der Hörspielfassung von Hans Rudolf Hubler aus dem Jahr 1966. Der Reihe wurde immerhin als Kommentar mit auf den Weg gegeben, der Autor gelte vielen als «ein Garant für die heile, bäuerliche Welt einer Schweiz im Stillstand. Dabei geht gern vergessen, dass Gotthelf zu Lebzeiten höchst umstritten war. Nicht nur literarisch, sondern vor allem in seiner bürgerlichen Existenz als Pfarrer. Mit seinem schriftstellerischen Schaffen ging es ihm nicht in erster Linie um die Schilderung von ländlicher Lebensweise, sondern um die Zeitkritik aus der Kraft der biblischen Botschaft heraus.»

(Foto: Unternehmensarchiv SRF, Radiostudio Bern)
Nach der Ausstrahlung der zwölf Folgen von Gotthelfs erstem Romanwerk «Der Burespiegel» von 1962 in der Radiofassung desselben Autors ebbte die erste Gotthelf-Welle im 21. Jahrhundert fürs Erste wieder ab. Auch dieses Produkt der sechziger Jahre wurde angekündigt als «ein Gegenbild zum romantisierenden Bauernbild des Biedermeier», das «Missstände wie korrupte Gemeindebeamte, Verdingwesen oder Schulsystem» anprangere. Eine sehr freie Adaption von «Elsi, die seltsame Magd», geschrieben für das Laientheater vom sehr erfahrenen Hörspielautor Markus Michel, wurde 1998 auch als Hörspiel umgesetzt und 2023 im Programm von Radio SRF wiederholt. Wer weiss, vielleicht kündigt sich damit eine weitere Gotthelf-Welle an. – Vielleicht auch nicht. Die Verhältnisse haben sich verändert, seit das Publikum nicht mehr dem Diktat des linearen Radioprogramms unterworfen ist. Wer heute Appetit auf Emmentaler Fastfood hat, kann sich jederzeit am Stand des SRF-Archivs alimentieren.
Bitzius würde sich wundern, wenn er vom Nachleben seines Werkes in den Unterhaltungsmedien des technischen Zeitalters wüsste. Wahrscheinlich wollten die Exponenten des Berner Produktionsstandorts 1946 die Konkurrenz zu den schon während der späten Kriegsjahre erfolgreichen Zürcher Strassenfeger-Dialektserien aufnehmen. Ein vergleichbarer Boom war aber nur durch Trivialisierung von Gotthelfs Vorlagen zu erreichen, was man allerdings nicht in erster Linie Ernst Balzli vorwerfen sollte. Seine Nachdichtungen waren zwar langfädig, aber immerhin wirkungsvoll dramatisiert und erzielten den gewünschten Erfolg. Ein kongenialer Dichter ist an Balzli aber sicher nicht verloren gegangen. Die mundartliche Aufbereitung wirkt, zumal für heutige Ohren, folkloristisch und mit antiquierten Preziosen überladen, wie in der Debatte zu Recht kritisiert wurde.
Die erst nach der Wiederholung einsetzende Kritik von Schmocker und Muschg war unnötig heftig und elitär überzogen, aber in der Sache gerechtfertigt, da eine Verfestigung des verfälschten Gotthelfbildes befürchtet werden musste. Immerhin gab es auch vermittelnde Stimmen, unter denen Werner Weber nur der prominenteste Vertreter war. Die episch umrahmten Adaptionen von Theres und Rudolf Stalder zeigen, dass der Einschnitt durch die Debatte der fünfziger Jahre nötig und bedingt erfolgreich war. Damit wurde auch klar, dass Gotthelf nicht auf Teufel komm raus popularisiert werden muss, um auf breiter Basis rezipiert zu werden. So konnten sich die Gotthelf-Hörspielfolgen sogar zwei Jahrzehnte länger halten als die Zürcher und Basler Dialekt-Serien und gehören in Form von Wiederholungen und im jedermann zugänglichen Archiv bis heute zum eisernen Bestand des Deutschschweizer Radios. Auch dazu könnte man mit Beat Sterchi sagen: «Nicht schlecht für einen Mann, der das Theater verachtete und schon in „Ueli der Knecht“ das Hornussen weit höher einschätzte als das „fratzenhafte Komödienspielen“.»
«Bitzius». Ein biographisches Hörspiel
Die Frage ist also, weshalb es denn Gotthelf sein muss und ob an die Stelle all dieser mehr oder weniger adäquaten Bearbeitungen nicht Originalhörspiele treten könnten. Der versierte, auch für Radio SRF tätige deutsche Hörspielautor Ulrich Bassenge kritisiert in seinem Essay «Wie das Hörspiel auf den Hund kam» die zunehmende Praxis der Adaption von Romanen, Erzählungen und Theaterstücken als «vertane Chancen auf autonome Radiokunst oder zumindest auf speziell für das Radio geschriebene Texte. Geld, das Hörspielautorinnen und -autoren nicht verdienen.» In der Schweizer Hörspielgeschichte hat das biografische Hörspiel sich im Laufe der Jahrzehnte mit unzähligen historischen Persönlichkeiten, auch mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern, zum Beispiel mit Gottfried Keller, befasst – nicht aber mit Gotthelf. Auf ihn als Thema kam erst der Berner Autor Beat Sterchi, der im Gotthelfjahr 2004 nach intensiver Auseinandersetzung mit den Schriften des Dichters in seinem Hörspiel «Bitzius» das thematisierte, was die Stalderschen Bearbeitungen auszudrücken anstrebten: dass Gotthelf zu seiner Zeit höchst umstritten war und dass es ihm um Zeitkritik, nicht um die Idylle einer ländlich-bäuerlichen «Schweiz im Stillstand» ging. Dass hier der reale Emmentaler Schriftsteller zu Wort kommen soll, wird schon aus dem Titel des Hörspiels klar. Regie führte der erfahrene Berner Dramaturg und Regisseur Charles Benoit.
Thema von Sterchis Hörspiel ist nicht der Inhalt von Gotthelfs dichterischen Werken. Wir lernen hier Bitzius kennen als Familienvater, Briefschreiber und Prediger. Der Pfarrer von Lützelflüh spielt zwar, umgeben von seiner Frau, seinen beiden Töchtern und seiner Halbschwester, eine traditionell patriarchale Rolle, heisst seine Frau die Post sichten, seine Briefe mit Sand bestreuen und versiegeln, die Schwester den Garten bestellen. Aber die Frauen vertreten auch selbstbewusst ihre eigene Meinung, referieren die Argumente seiner Gegner und kritisieren ihn zuweilen unverblümt. «Aber Albert…» und: «Säg, Albert, dasch de hingäge tumms Züüg!», wiederholt seine Frau fast leitmotivisch, und verdeutlicht ihre Sicht, als die Stahlfabrikanten von Roll von Gerlafingen auf seine Polemik reagieren: «Albert, werum, werum ouch immer so heftig, werum so spitz, werum ouch immer so verletzend?» Nicht nur wegen seiner Briefe und seiner sozial-politischen Brandreden von der Kanzel eckt er an, sondern auch als Schulkommissar, der sich sowohl gegen Schulverweigerer unter den Bauern wie gegen verstockte, fehlbare Schulmeister wendet. Die Quittung folgt in Form der Kündigung des Berner Erziehungsdepartements in gedrechseltem Amtsdeutsch. Frau Henriette übersetzt in Klartext: «Albert, si hei di entlaa!» Sein Hörspiel-Biograph zieht eine klare Bilanz: «Würde Gotthelfs Meisterschaft […] auf heutige Zustände angewendet, es wäre schnell vorbei mit seiner Popularität.»
Man lernt hier in wörtlichen Auszügen aus Briefen, Reden, Artikeln und Predigten einen weithin unbekannten kämpferischen Bitzius kennen. Aber dem Autor des Portäts geht es noch um etwas Anderes, was in all den Verhörspielungen kaum zum Ausdruck kam. Sterchi ist ein Sprachartist der SpokenWord-Bewegung, den nicht nur Inhalte interessieren, sondern vor allem auch der Ton, der im besten Fall die Musik macht. Zum Schluss soll hier zitiert werden, was er sich in seinem Exposé vorgenommen hatte – und was er weitgehend so realisiert hat:
«Der Formulierungskünstler, der unübertroffene Kleinmeister des Porträts, soll einmal nicht als Moralist, auch nicht als Pfarrer, sondern als Rhetoriker brillieren dürfen. In Kaskaden soll Gotthelfs Sprachreichtum auf den Hörer und auf die Hörerin prasseln, für einmal nicht syntaktisch wohl geordnet in bekannten Geschichten, auch nicht lebensanschaulich gesichtet und gewichtet, sondern nach Ton und Klang und Laune assoziiert. Ich möchte alphabetisch in ganz spezifische Wortfelder wie Landschaft, Tiere, Architektur, Landarbeit, Medizin, Ernährung, Wasser vordringen, möchte heftige Briefpassagen zu Dialogen formen oder schon existierende Dialoge verfremden, neu ordnen, überdrehen oder bei allem Respekt verdrehen. Denn mich interessiert hier nicht, was die Sprache transportiert, sondern die Wucht, mit der sie es tut. Das Ziel wäre, für das Radio einen gotthelfschen Klang zu erzeugen, der sich abhebt, von den oft herausgeputzten und verharmlosenden Hörspielen, die viele von uns für immer im Ohr haben, obschon sie Meister Bitzius nur bedingt gerecht werden.»
(Beat Sterchi)
